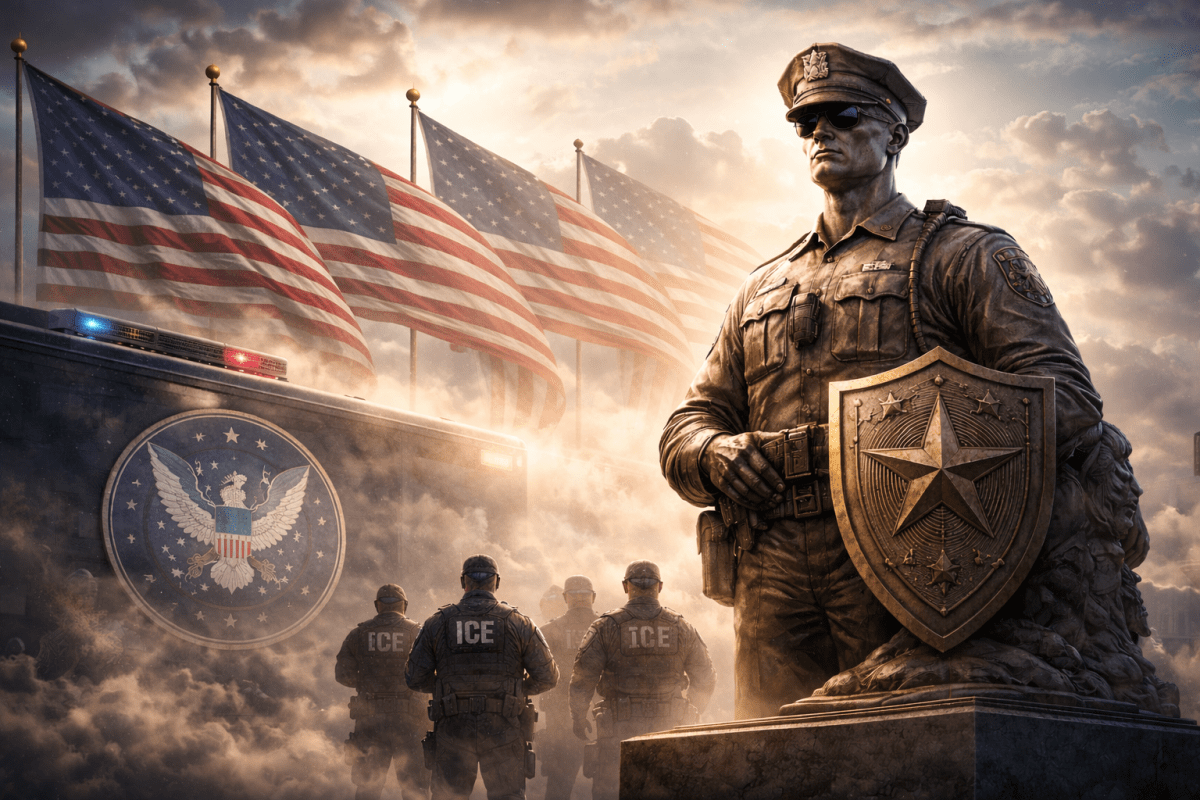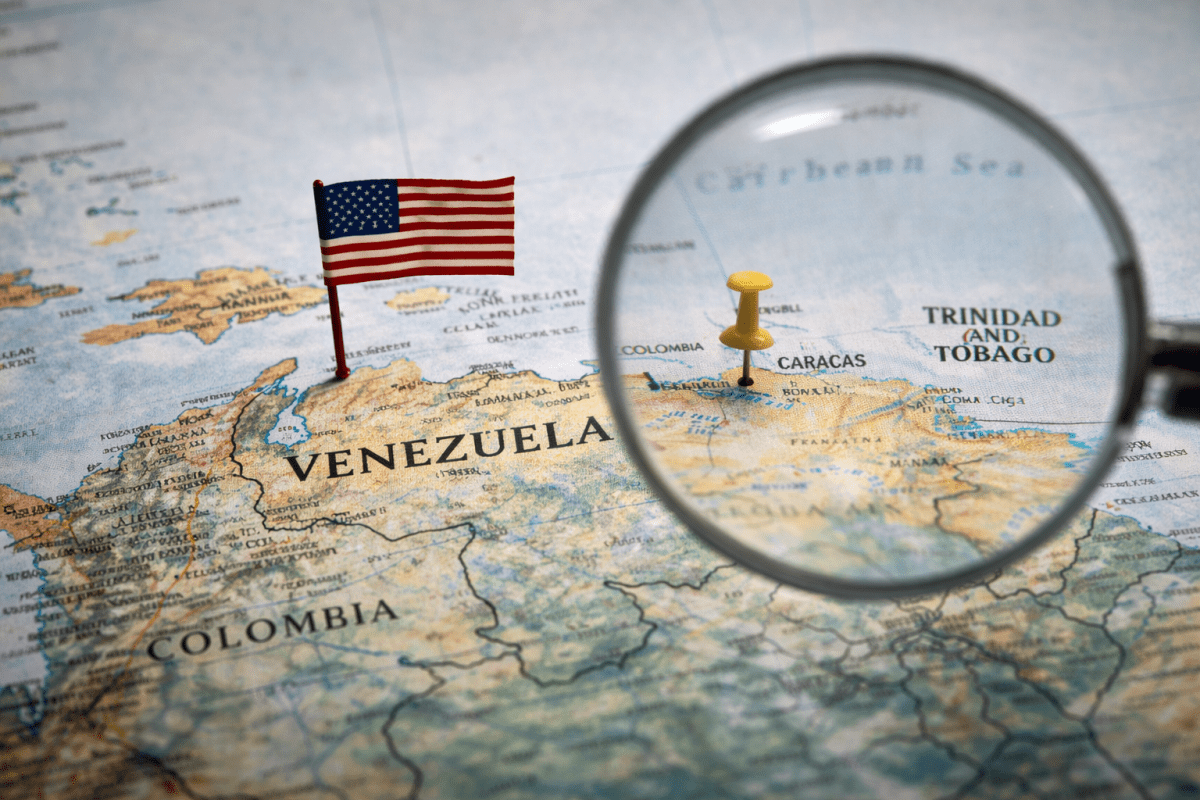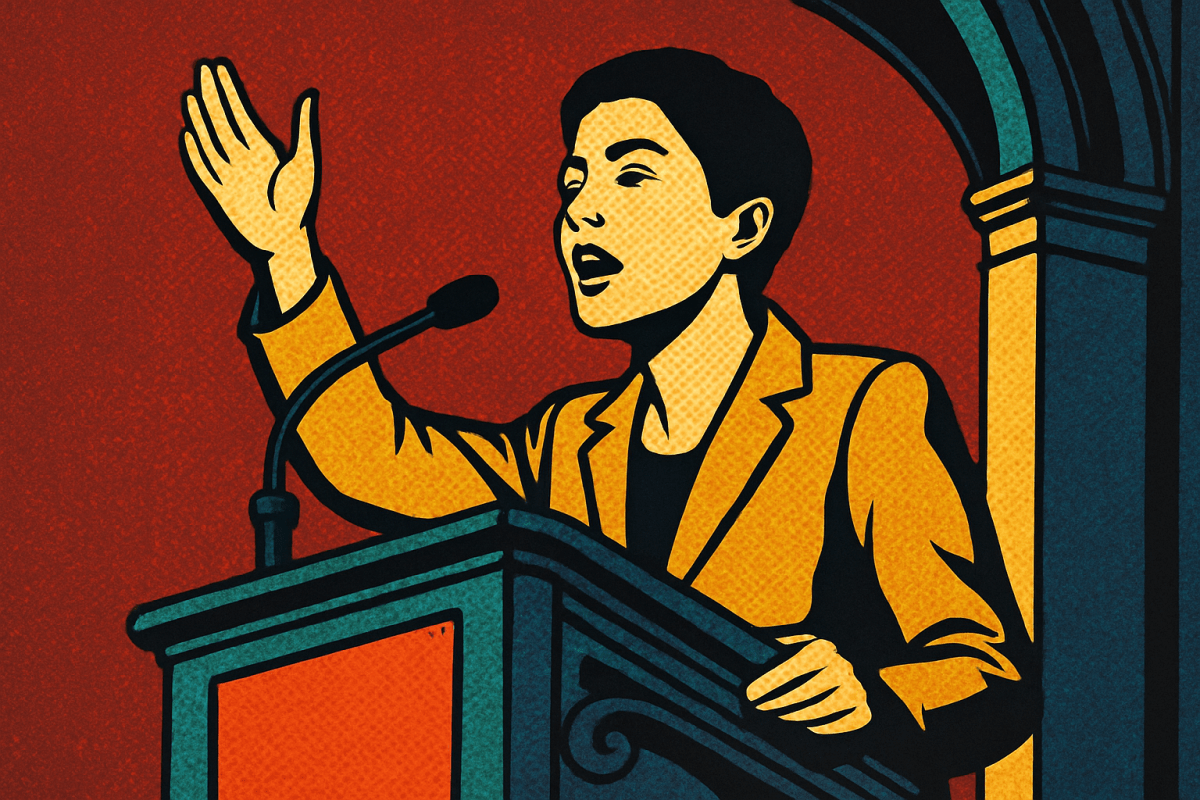Ein Wort als Bann und Geheimnis [Lesezeit 20 Minuten]
Es gibt Begriffe, die ihre Schärfe verloren haben, weil sie nicht mehr gedacht, sondern nur noch ausgesprochen werden. „Rechts“ ist ein solcher Begriff. In der Gegenwart ist er fast ausschließlich ein Bannwort, ein Synonym für das moralisch Verwerfliche, für Ausgrenzung und Gefahr. Man spricht ihn mit einem Unterton aus, der längst mehr über den Sprecher verrät als über den, der so bezeichnet wird. Wer „rechts“ sagt, meint zumeist „böse“, „reaktionär“, „unmenschlich“. Doch damit verrät er, dass er den Begriff nie durchdacht hat.
Denn Rechtssein ist älter als jede gegenwärtige Zuschreibung. Es verweist auf eine geistige Haltung, die tiefer reicht als die Schlagzeilen unserer Tage. Rechts bedeutet, der Realität die Treue zu halten. Es heißt, sich nicht in den Traumwelten einer gesellschaftlichen Utopie einzurichten, sondern das Gegebene anzuerkennen: Grenzen, Ordnungen, Traditionen, Gewachsenes. Rechtssein meint, dass man den Staat nicht als pädagogische Anstalt betrachtet, sondern als Ordnungsrahmen, der die wesentlichen Aufgaben erfüllt: Schutz der Grenzen, Sicherung der inneren Ruhe, Fürsorge für die Schwächsten. Alles Weitere ist Sache freier Bürger.
Diese Haltung ist nicht gleichbedeutend mit Unterdrückung, sondern mit Freiheit – einer Freiheit, die aus Bindung erwächst. Der Mensch ist kein isoliertes Konstrukt, das sich jederzeit neu erfinden könnte, sondern ein Wesen, das Sprache, Herkunft, Geschichte in sich trägt. Die Rechte nimmt diese Verwurzelung ernst und erkennt gerade darin die Würde des Einzelnen.
Die historische Dimension
Die Spannung zwischen links und rechts ist nicht naturgegeben, sondern historisch gewachsen. Sie hat ihren Ursprung in der Französischen Revolution. Dort saßen die Verteidiger von Krone und Kirche rechts vom Präsidenten, die Revolutionäre links. Aus einer schlichten Sitzordnung erwuchs ein Symbol, das bis heute prägend ist.
Von da an stand „rechts“ für Bewahrung, Kontinuität, Bindung; „links“ für Umsturz, Gleichheit, Experiment. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Inhalte, aber die Grundspannung blieb. Rechts meinte stets: Achtung vor der Nation, Respekt vor Religion, Verteidigung von Familie und Eigentum. Links meinte: Umwälzung, Gleichmacherei, Versuch, den Menschen neu zu schaffen.
Heute ist der Gegensatz verschoben. „Rechts“ meint, der Globalisierung zu widerstehen, die Identität zu bewahren, die kulturelle Souveränität zu verteidigen. „Links“ bedeutet, den Menschen als leeres Blatt zu betrachten, das nach Belieben beschrieben werden kann. Hier zeigt sich der eigentliche Antagonismus: die Linke lebt von der Utopie, die Rechte von der Realität.
Die Geschichte bezeugt, dass Utopien fast immer in Tyrannei enden. Sie beginnen mit dem Traum von Gerechtigkeit und enden im Zwang zur Gleichheit. Die Rechte dagegen vertraut dem, was gewachsen ist: den Sedimenten der Geschichte, den Biographien und Traditionen. In der Philosophie finden wir hier Parallelen: Sartres Bild vom „Hingeworfensein“ als Ausdruck der Absurdität, Heideggers Begriff des „In-der-Welt-Seins“ als Beschreibung der Verbindlichkeit des Gegebenen. Für die Linke ist die Kontingenz des Daseins Anlass zum Aufbruch, für die Rechte Anlass zur Anerkennung.
Wer das Rechte nur politisch begreift, bleibt an der Oberfläche. Rechtssein ist nicht allein eine Frage von Programmen oder Parteitagen, sondern eine Frage der Form. Form meint Maß, Ordnung, Grenze. Sie ist die sichtbare Gestalt, die zugleich unsichtbare Kräfte bindet. Goethe sprach von Urgestalten, Ernst Jünger erkannte in der Figur des „Arbeiters“ eine neue Form des Menschseins, die das zwanzigste Jahrhundert prägen sollte. Ein Archetyp der übergeschichtlich präsent ist. Gestalt ist nie abstrakt, sondern immer gebunden: an Kultur, an Sprache, an Biographie. Ohne Form zerfließt das Leben, ohne Gestalt verkommt der Mensch zum Rohmaterial.
Hier liegt auch der tiefe Gegensatz zum Liberalismus. Der Liberalismus versteht sich gern als neutrale Mitte, als vernünftiger Ausgleich. Doch Armin Mohler hat in seinem Buch „Gegen die Liberalen“ gezeigt, dass Liberalismus in Wahrheit selbst eine Ideologie ist: eine, die auf Auflösung zielt. Indem er das Individuum zum Maß aller Dinge erhebt, trennt er es von Herkunft, Geschichte, Gemeinschaft. Gesellschaft wird so zu einem Aggregat, Freiheit zur Beliebigkeit. Die Rechte hingegen weiß: Der Mensch ist frei nicht trotz, sondern wegen seiner Bindungen. Freiheit ohne Form ist Anomie, nicht Freiheit.
Die Rechte begreift Gestalt als das, was uns Halt gibt. Gestalt ist nicht starr, sondern lebendig – sie formt und wird geformt. In ihr liegt eine Spannung von Immaterialität und Gebundenheit: Sie ist mehr als Materie, aber niemals abstrakt. Sie ist das, was Kultur, Sprache, Tradition zu einer lebendigen Form verdichtet. In diesem Sinn ist die Rechte eine Philosophie des Maßes und der Gestalt.
Mythos und Religion
Doch auch die Form braucht eine Seele. Ein Volk lebt nicht von Ordnungen allein, sondern von Erzählungen. Thor von Waldstein hat darauf hingewiesen: jedes Volk braucht einen Mythos. Der Mythos ist nicht bloß eine Sage, sondern die große, verbindende Erzählung, die ein Volk trägt. Er ist das unausgesprochene Wissen, das ohne Worte anerkennt, was ist.
In modernen Begriffen würde man von „Narrativ“ sprechen – doch das Wort ist kalt, technisch, blutleer. Mythos ist mehr: Er ist das Epos einer Gemeinschaft, die symbolische Rückbindung an Herkunft und Schicksal. Darum ist er auch eng mit Religion verbunden. Schon der Begriff religere bedeutet Rückbindung – Rückbindung des Einzelnen an das Ganze, des Endlichen an das Unendliche. Religion lebt vom Mythos, und Mythos wird in Religion geweiht.
Ein Volk ohne Mythos ist ein Volk ohne Seele. Es mag Institutionen haben, Gesetze, Parlamente – doch ohne das gemeinsame Band, das über das bloß Rationale hinausgeht, bleibt es ein bloßes Nebeneinander. In diesem Sinn erkennt die Rechte: ohne Mythos keine Identität. Ohne Religion keine Rückbindung. Ohne Seele keine Gestalt.
Dass Rechtssein heute als Makel gilt, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen kulturellen Arbeit. Rudi Dutschke prägte einst die Formel vom „Marsch durch die Institutionen“. Was zunächst wie ein Schlagwort klang, wurde zur Strategie: linke Aktivisten eroberten Schulen, Universitäten, Redaktionen, Theater, Verlage. Sie besetzten die Räume, in denen Begriffe geprägt, Erzählungen verbreitet, Deutungen verankert werden.
Über Generationen hinweg wirkte dieser Prozess. Schüler lernten früh, dass „rechts“ gleich „Nazi“ sei, Studenten übernahmen diese Denkfigur, Journalisten schrieben sie fort, Politiker machten sie zum Konsens. Am Ende stand eine Sozialisation, die tief in die Köpfe einsickerte: „Kein Schritt nach rechts“, „kein Spaltbreit den Rechten“.
Psychologie und Sozialisation
Man kann diesen Prozess nicht nur politisch, man muss ihn auch psychologisch deuten. Viele Menschen heute können gar nicht anders, als „rechts“ mit „Nazi“ gleichzusetzen, weil sie es so gelernt haben. Es ist ein Reflex, der sich über Jahre hinweg verfestigt hat. Wer abends die Tagesthemen schaut, nimmt ihn unwillkürlich auf; wer nie tiefer nachdenkt, für den bleibt er die einzig verfügbare Kategorie.
Dabei hat diese Sozialisation zwei Seiten: einerseits die mangelnde begriffliche Auseinandersetzung, andererseits die moralische Prägung. Man lernt, dass Rechtssein schlecht ist, und man lernt es mit einer moralischen Emphase, die tief ins Gefühl reicht.
Die Hypothek der 90er
Hinzu kommt eine historische Hypothek, die die Rechte bis heute belastet. Die 90er Jahre, geprägt von Bomberjacken, Glatzen, dumpfen Parolen, haben ein Bild erzeugt, das bis heute nachwirkt. Jene alte Subkultur der Rechten war in ihrer Ästhetik, in ihrer Sprache, in ihrem Habitus abschreckend. Sie war das genaue Gegenteil dessen, was eine intellektuelle Rechte heute sein will. Doch ihre Bilder sind in den Köpfen geblieben – und prägen bis heute die Wahrnehmung.
Man muss fairerweise sagen: Diese Szene hat viel dazu beigetragen, dass Rechtssein und Nazisein bis heute gleichgesetzt werden. Wer in den 90ern jung war, trägt diese Assoziation noch in sich. Dass es heute eine Neue Rechte gibt, die intellektuell, emanzipatorisch, kulturschaffend ist, wird im Mainstream noch kaum wahrgenommen.
Projektion und die Projektionsfigur-Figur Höcke
In einer Gesellschaft, die so stark von Sozialisation geprägt ist, braucht es Projektionsflächen, an denen sich die kollektive Abwehr festmachen kann. Björn Höcke ist eine solche Figur. Für viele gilt er als das personifizierte „rechte Schreckgespenst“. Man könnte sagen: Er ist der Guardian, der Wächter der Projektion – notwendig, damit sich der Durchschnittsbürger seiner eigenen moralischen Reinheit versichern kann.
Dazu trägt nicht nur sein Auftreten, sondern sogar seine Physiognomie bei. Für viele reicht schon der Seitenscheitel, die blauen Augen, der gerade Blick, um ihn zum „Nazi“ zu stempeln. Das Bild genügt, um jahrzehntelange Stereotype zu bestätigen. In ihm erkennen sie nicht den Intellektuellen, den Geschichtslehrer, den Autor, sondern den Zerrspiegel der eigenen Vorurteile.
Doch wer genauer hinsieht, erkennt ein ganz anderes Bild. In seinen Büchern – etwa in Nie zweimal in denselben Fluss – finden sich keine rassistischen Tiraden, keine menschenverachtenden Parolen. Im Gegenteil: Höcke argumentiert auf einem hohen intellektuellen Niveau, getragen von historischem Wissen und tiefem humanistischen Ernst. Sein Denken kreist nicht um Ausgrenzung, sondern um Bewahrung; nicht um Hass, sondern um Verantwortung.
Die Projektion, die er auslöst, verrät also weniger über ihn als über die Gesellschaft, die ihn betrachtet. Der Durchschnittsbürger braucht Figuren, an denen er sich abarbeitet. An Höcke kann er sich seiner eigenen moralischen Position versichern: Indem er ihn ablehnt, fühlt er sich auf der „richtigen Seite“ der Geschichte. Psychologisch gesehen ist Höcke damit weniger ein Politiker als ein Spiegel: Er spiegelt die Ängste, Reflexe und Selbstvergewisserungen einer Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was „rechts“ bedeutet.
Semantische Flucht und die Identitäre Bewegung
Mancher glaubt, der gesellschaftlichen Stigmatisierung ließe sich entkommen, indem man das Kind einfach anders nennt. Statt „rechts“ sagt man „patriotisch“, „alternativ“, „konservativ“. Doch das ist eine Illusion. Es wäre nichts anderes als eine Kapitulation vor dem Bannwort. Wer sich umbenennt, erkennt den Bann an und bestätigt ihn damit nur. Die Aufgabe besteht nicht darin, semantische Ausweichmanöver zu vollführen, sondern dazu zu stehen, was man ist.
Hier berührt sich die Frage nach Begriffen mit der Frage nach Gesten. Niemand hat für die Neue Rechte so geprägt wie Martin Sellner. Er hat die Identitäre Bewegung nicht nur initiiert, sondern ihr Sprache und Theorie gegeben, wie kaum ein anderer. Er hat – gemeinsam mit Kubitschek et. al. – den intellektuellen Boden bereitet, von dem aus die Rechte in einer neuen Generation sprechen konnte.
Doch so viel man ihn und sein Werk schätzen muss, so sehr muss man zugleich erkennen, dass die identitäre Bewegung selbst in manchem eine Pubertät der Rechten darstellte. Ihre Aktionen waren kraftvoll, aufmerksamkeitsstark, mitunter genial in der Symbolik – aber eben auch jugendlich-provokativ, theatralisch, von einer Pose getragen, die falsche Bilder weckte. Für die Öffentlichkeit vermittelte sie nicht selten einen Eindruck von Militanz, der der Sache mehr schadete als nützte.
Die Identitäre Bewegung hatte ihre Stunde, sie war notwendig und legitim. Aber sie darf nicht Endpunkt bleiben. Man könnte sagen: Sie war das Aufbrechen der Stimme im Prozess des Erwachsenwerdens. Heute aber geht es darum, die Stimme zu festigen, die Sprache zu finden, die nicht nur provoziert, sondern überzeugt. Die Neue Rechte muss aus der jugendbewegten Geste herauswachsen und zu einer erwachsenen Kraft werden. Sie muss Reife zeigen, Würde, Ernst. Nur dann kann sie jene kulturelle Autorität entfalten, die ihre Ideen verdient haben.
Die AfD zwischen Klarheit und Breite
Wenn wir vom Politischen im engeren Sinn sprechen, führt kein Weg an der AfD vorbei. Sie ist derzeit das einzige parlamentarische Gefäß, in dem rechte Positionen eine Stimme haben. Doch genau deshalb steht sie vor einer doppelten Herausforderung. Einerseits muss sie Klarheit zeigen, darf sich nicht treiben lassen in den den Manegen des gesellschaftlichen Diskurses. Andererseits darf sie sich nicht zur monothematischen Partei verengen.
Die Frage der Migration ist zweifellos das Herzstück ihres Profils. Sie ist die Schicksalsfrage, an der sich entscheidet, ob dieses Land kulturell und politisch bestehen kann. Wer hier ausweicht, verwässert die Sache selbst. Und dennoch: Eine Partei, die Zukunft haben will, darf nicht in dieser einen Frage aufgehen. Sie muss Antworten geben auf die Breite der Herausforderungen, die die Menschen bewegen – Energie und Wirtschaft, Bildung und Familie, Sozialpolitik, Kultur und Souveränität.
Das Parteiprogramm der AfD gibt diese Antworten her. Sie stehen schwarz auf weiß, wohlüberlegt, nicht selten mit einer Tiefe, die im medialen Alltag völlig übersehen wird. Doch das Problem liegt in der Kommunikation. Zu oft bleibt die AfD nach außen auf das Schlagwort Migration reduziert. Teils, weil die Gegner es so zuspitzen, teils, weil die Partei selbst zu wenig daran arbeitet, die Breite ihres Profils sichtbar zu machen.
Hinzu kommt eine innere Gefahr: die Neigung, sich in Flügelkämpfen zu erschöpfen oder gar auseinanderzubrechen. Besonders sichtbar wird das am Beispiel Maximilian Krah. So tritt er mitunter in einer Sprache auf, die für viele wie eine Relativierung der Kernfrage wirkt: Statt das Wort „Remigration“ stark zu machen, spricht er plötzlich und wie aus dem Nichts lieber von Integration, von ordentlichen Verfahren, von differenzierten Lösungen. Das mag im Brüsseler Betrieb als Realpolitik erscheinen, für die Basis aber ist es ein Verrat an der Schärfe, die die AfD stark gemacht hat. Und sofort entzündet sich der Streit: Ist Krah der Brückenbauer in eine breitere Akzeptanz – oder ist er der Aufweicher, der das Profil der Partei verwässert? Genau hier liegt die Spaltung: zwischen jenen, die taktisch lavieren wollen, und jenen, die klare Kante fordern.
Gerade jetzt, wo die AfD die Möglichkeit hätte, zu einer ernsthaften Volkspartei zu reifen, darf sie sich nicht in solchen Konflikten verstricken. Sie muss an Kernforderungen festhalten – Remigration, Identität, Souveränität – und zugleich die Breite ihres Programms mutig vertreten. Nur so verhindert sie, dass sie von Gegnern auf ein Schlagwort reduziert wird und von inneren Spaltungen geschwächt.
Die Rechte als letzte revolutionäre Kraft
Wer die politischen Landschaften nüchtern betrachtet, erkennt: die Linke hat ihren revolutionären Charakter verloren. Sie ist ins Establishment integriert, ihre einstigen Aufbrüche sind zur Verwaltung geworden. Aus der Revolte wurde Routine. Revolutionär ist heute allein die Rechte.
Doch ihre Revolution ist nicht die Utopie, nicht die Flucht in ein „Noch-nicht-Sein“, sondern die Wiederherstellung des Wirklichen. Sie ist der Mut, der Realität treu zu bleiben in einer Zeit, die alles in Konstruktionen auflösen will. Sie ist die Verteidigung der Gestalt gegen das Formlose, der Identität gegen das Beliebige, des Eigenen gegen die Zumutung einer globalen Gleichschaltung.
Antonio Gramsci hat gelehrt, dass kulturelle Hegemonie entscheidend sei. Die Linke hat diese Lektion längst verinnerlicht. Aber Ellen Kositza hat recht, wenn sie ergänzt: Die Rechte steht nicht nur für Begriffe und Diskurse, sondern für Vitalität. Sie ist das Prinzip des Lebendigen, das sich nicht domestizieren lässt. Sie steht für das Unmittelbare, das Körperhafte, das aus Geschichte, Biographie, Kultur schöpft. Vitalität bedeutet, dass eine Bewegung nicht nur denkt, sondern lebt.
So gesehen ist es heute geradezu revolutionär, an der Wirklichkeit festzuhalten. Revolutionär ist es, sich zur Nation zu bekennen, wenn alle von Globalität reden. Revolutionär ist es, an der Familie festzuhalten, wenn sie aufgelöst wird. Revolutionär ist es, Grenzen einzufordern, wenn sie systematisch verwischt werden. Die Rechte ist die letzte Revolution – nicht als Traum, sondern als Rückbindung.
So paradox es auf den ersten Blick scheinen mag, auch in der Geschichte der Linken finden sich rechte Regungen – Keime, die aber nie zur vollen Entfaltung kamen. Ferdinand Lassalle, einer der Gründerväter der deutschen Arbeiterbewegung, war ein Patriot. Er sprach von der Notwendigkeit, die soziale Frage mit der nationalen Einheit zu verbinden. Für ihn war die Befreiung der Arbeiterklasse nicht denkbar ohne den Aufbau eines starken deutschen Nationalstaates.
Diese Gedanken standen quer zu einer Linken, die zunehmend internationalistisch dachte. Lassalle wusste: Ein Volk, das keine Identität hat, kann auch keine soziale Solidarität entfalten. Er ahnte, dass Nation und Sozialfrage sich nicht trennen lassen. Doch seine Position blieb Episode. Später dominierte in der Linken das Misstrauen gegenüber allem, was nach Heimat klang. Patriotismus wurde zum Verdacht, Nation zum Bannwort.
Und doch lohnt der Hinweis: In den Anfängen selbst der Linken war das Wissen lebendig, dass Identität keine leere Hülse ist. Selbst dort schimmerte durch, dass Kultur und Herkunft nicht beliebig sind. Diese patriotischen Untertöne blieben Randnotizen, fast schon Fußnoten der Geschichte. Aber sie zeigen, dass das Eigene auch in den Reihen der Gegner nie völlig verdrängt werden konnte. Es ist, als ließe sich das Nationale nie ganz austreiben, selbst wenn man es leugnet.
Die wohl tiefgreifendste Veränderung unserer Zeit liegt darin, dass das politische Koordinatensystem selbst verrückt wurde. Was einst Mitte war, gilt heute als Rand. Alles, was rechts von der CDU steht, wird automatisch als „rechtsradikal“ etikettiert, selbst wenn es nur klassischen Konservatismus vertritt. Die Altparteien, getrieben vom linken Zeitgeist, haben sich Stück für Stück in ein Milieu verschoben, in dem jede Abweichung nach rechts zum Verdachtsfall wird.
Franz Josef Strauß konnte noch in aller Selbstverständlichkeit vom „grünen Narrenschiff“ sprechen, ohne dass jemand darin ein extremistisches Bekenntnis sah. Er sprach mit der Schärfe eines Mannes, der wusste, dass Politik Zuspitzung braucht, und er tat es im Bewusstsein, in der bürgerlichen Mitte verankert zu sein. Heute jedoch würden dieselben Worte den medialen Alarm auslösen, sie würden als „Hetze“ gebrandmarkt, Strauß würde zum Paria erklärt.
Wie sehr sich die Maßstäbe verschoben haben, zeigt ein Satz aus dem Munde Oke Göttlichs, des Präsidenten des FC St. Pauli. In einer Fernsehsendung erklärte er, sein Verein sei „nicht rechtsoffen“. Damit sagte er nichts anderes, als dass allein schon das Rechtssein – nicht das Extrem, nicht das Radikale – als Makel gilt. „Rechts“ genügt, um ausgeschlossen zu werden. Der Begriff selbst ist zum Bannwort geworden, zum Etikett, das moralisch disqualifiziert.
Die Linke wiederum hat, indem sie sich ganz der Identitätspolitik verschrieben hat, ihre eigene historische Rolle preisgegeben. Was einst der Anspruch war, eine soziale Bewegung für alle Unterdrückten zu sein, ist zur kleinteiligen Politik der Opfergruppen zerfallen. In dieser Fragmentierung hat sie ihre Kraft verloren – und sich unmerklich zum Steigbügelhalter der Systemparteien gemacht. Sie liefert ihnen die moralische Sprache, mit der sie ihre Macht absichern, und verliert darüber selbst ihren revolutionären Anspruch.
Ein Blick in di Literatur zeigt, dass diese Identitätspolitik nicht zufällig, sondern nach einem inneren Muster funktioniert: Sie produziert eine Hierarchie der Opfergruppen. Kimberlé Crenshaw, die Theoretikerin des „Intersectionality“-Ansatzes, beschreibt, wie Identitäten sich überlagern und zu unterschiedlichen Abstufungen von Unterdrückung führen. Judith Butler wiederum, eine der einflussreichsten Stimmen der Queer Theory, erklärte, dass Geschlecht nicht naturgegeben sei, sondern performativ hergestellt werde. Damit öffnete sie das Feld für eine endlose Differenzierung, die letztlich jede biographische Eigenheit politisch auflädt.
In der Praxis bedeutet das: Wer als weißer, heterosexueller Mann geboren ist, steht ganz unten in dieser neuen Moralordnung. Wer hingegen gleich mehrere Merkmale der Benachteiligung in sich trägt – etwa migrantische Herkunft, nicht-heterosexuelle Orientierung und weibliches Geschlecht –, steigt in der Hierarchie nach oben.
Rechte als vitale Kraft
Wer all dies zusammennimmt – die Verschiebung der Begriffe, die Stigmatisierung, die Projektionen, die inneren Konflikte der AfD, die Fragmentierung der Linken –, erkennt ein paradoxes Bild: Die Rechte ist heute die einzige verbliebene Kraft, die den Anspruch auf Ganzheit noch verteidigt. Während die Linke sich in immer kleinteiligere Opfergruppen zerlegt und damit zum Steigbügelhalter des Systems geworden ist, während die Altparteien ihren Kompass im Strudel des Zeitgeistes verloren haben, bleibt die Rechte als letzte vitale Bewegung bestehen.
Rechtssein bedeutet nicht Rückfall in finstere Zeiten, nicht Nostalgie, nicht Reaktion. Rechtssein bedeutet Bindung an Realität, an Form, an Geschichte, an Mythos. Es bedeutet, die Gestalt des Menschen in seiner kulturellen und biographischen Verwurzelung ernst zu nehmen. Es bedeutet, Patriotismus nicht als Schimpfwort, sondern als Tugend zu begreifen. Es bedeutet, Vitalität zu verkörpern, dort wo andere nur abstrakt reden.
In diesem Sinne ist die Neue Rechte tatsächlich die letzte revolutionäre Kraft. Denn revolutionär ist heute nicht mehr, die Gesellschaft in Utopien aufzulösen – das ist zur Routine geworden, zum Establishment. Revolutionär ist heute, die Realität anzuerkennen, Grenzen zu setzen, Identität zu verteidigen. Revolutionär ist, an das Eigene zu glauben, ohne das Fremde zu hassen. Revolutionär ist, die Vielfalt der Völker zu bewahren, anstatt sie in einem globalen Einheitsbrei zu verflüssigen.
Das Projekt der Neuen Rechten ist damit mehr als Politik. Es ist ein kulturelles, intellektuelles, ja existentielles Projekt. Es will Sprache erneuern, Begriffe schärfen, Mythen lebendig halten. Es will der Gesellschaft zurückgeben, was sie verloren hat: Maß, Würde, Identität, Selbstbewusstsein. Und es verlangt zugleich, erwachsen zu werden, sich aus jugendlichen Gesten zu lösen, Reife und Ernst auszustrahlen.
Die Hypothek der Vergangenheit mag schwer sein. Doch wer begreift, dass „rechts“ nicht Stigma, sondern eine selbstverständliche Richtung des politischen Spektrums ist, kann diese Last in Stärke verwandeln. Rechts ist kein Bannwort, sondern eine Haltung. Sie ist keine Gefahr, sondern eine Möglichkeit – vielleicht die letzte Möglichkeit, in einer auseinanderdriftenden Welt die Gestalt des Eigenen zu wahren.