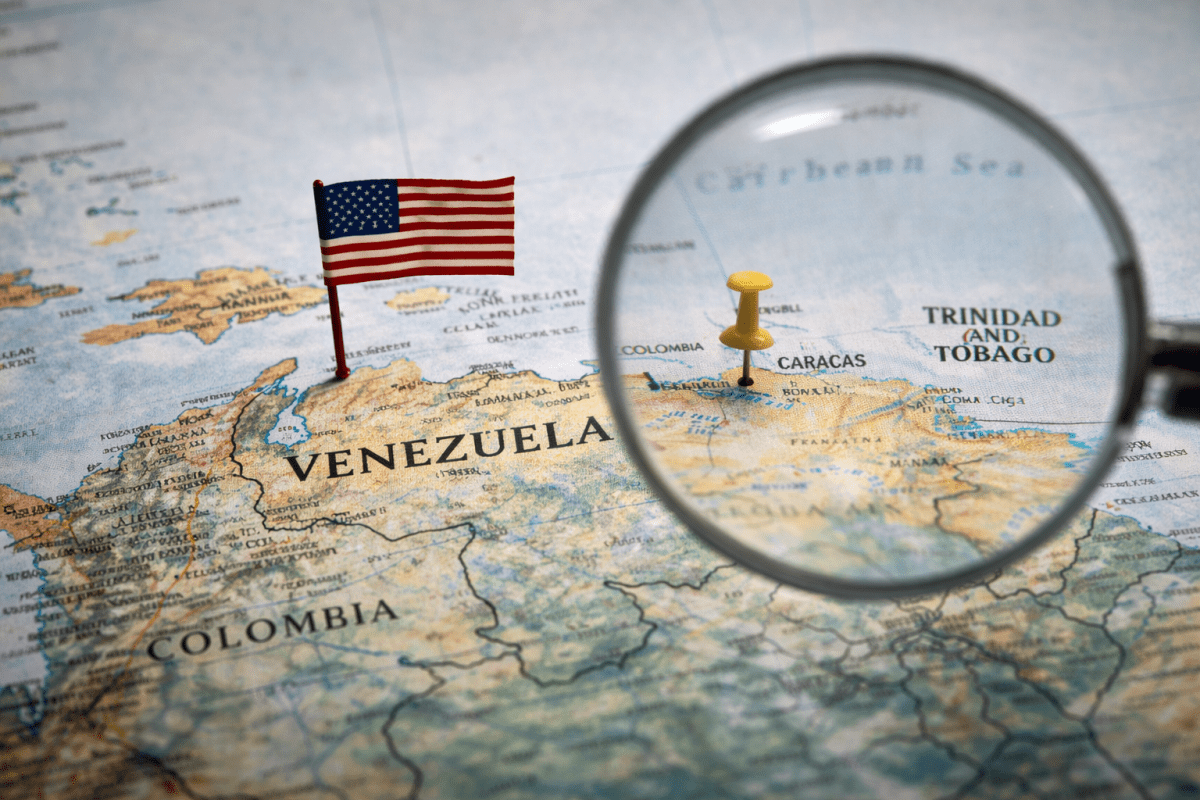Moral ist ein schlechter Kompass für Machtfragen. Sie schlägt aus, sobald Interessen ins Spiel kommen, und zeigt meist dorthin, wo wir uns selbst verorten wollen. Internationale Politik jedoch kennt keine Himmelsrichtungen – nur Einflusszonen. Wer versucht, sie moralisch zu deuten, verwechselt Orientierung mit Erklärung.
Der amerikanische Eingriff in Venezuela ist dafür ein exemplarischer Fall. Er offenbart nicht nur die Logik geopolitischer Macht, sondern auch unsere eigene Neigung, politische Realität in moralische Lager zu übersetzen. Gut gegen Böse, Recht gegen Unrecht, Werte gegen Willkür. Doch genau diese Übersetzung ist Teil des Problems.
Die Operation trägt den bezeichnenden Namen „Absolute Resolve“. Absolute Entschlossenheit. Schon im Titel liegt jene Hybris, die militärische Interventionen begleitet: der Anspruch, im Besitz einer höheren Wahrheit zu sein. Doch diese Wahrheit speist sich nicht aus humanitären Erwägungen, nicht aus dem Wunsch, ein unterdrücktes Volk zu befreien. Sie speist sich aus Geostrategie, aus Ressourcenfragen, aus Machtsicherung. Aus Interessen – klar, kühl, amoralisch.
Wer verstehen will, was hier geschieht, muss weiter zurückblicken. Weit zurück. Bis ins Jahr 1823, als der fünfte amerikanische Präsident James Monroe seine berühmte Doktrin formulierte. Die Monroe-Doktrin war nie ein moralisches Projekt. Sie war eine machtpolitische Grenzziehung: Amerika den Amerikanern – gemeint waren die Vereinigten Staaten. Europa sollte draußen bleiben, Lateinamerika zum Einflussraum Washingtons werden. Eine imperiale Logik, verpackt als Schutzversprechen.
Fast zweihundert Jahre später griff Donald Trump diesen Gedanken wieder auf – als „Donroe-Doktrin“. Der Name mag grotesk klingen, doch der Inhalt ist vertraut: die Sicherung der Vormachtstellung auf dem eigenen Kontinent. Venezuela ist in dieser Logik kein souveräner Staat, sondern ein geopolitischer Störfaktor. Ein Land mit enormen Ölreserven, das sich dem westlichen Zugriff entzieht.
Hinzu kommt die moralische Verpackung dieses Zugriffs. Die USA begründen ihr Vorgehen damit, Venezuela von einem Diktator befreit zu haben. Der Präsident wird zum Drogenterroristen erklärt, zum Verbrecher, zur moralisch delegitimierten Figur. Doch genau diese Argumentation verbietet sich. Nicht zwingend, weil sie faktisch falsch wäre, sondern weil sie strukturell gefährlich ist. „Diktator“ und „Narco-Terrorist“ sind keine juristischen Kategorien, sondern moralische Kampfbegriffe. Sie ersetzen Analyse durch Zuschreibung und Recht durch Gesinnung.
Moral macht Wahrheit dehnbar wie Kaugummi. Je nach Bedarf lässt sie sich ziehen, drehen, zuschneiden. Heute ist jemand Staatschef, morgen Verbrecher. Heute Bündnispartner, morgen das personifizierte Böse. Die Maßstäbe dafür sind nicht universell, sondern opportun.
An diesem Punkt lohnt der Blick auf das Völkerrecht. In westlichen Demokratien gilt es als normative Instanz, als rechtliche und zugleich ethische Leitplanke internationaler Politik. Für Imperien jedoch ist das Völkerrecht weniger Handlungsrahmen als ein ethisch-philosophisches Konstrukt – weit entfernt von der täglichen Realität strategischer Entscheidungen. Es besitzt moralischen Anspruch, aber begrenzte Bindungskraft.
Nicht zufällig sind es ausgerechnet die Großmächte, die sich seiner selektiven Anwendung besonders sicher sind. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verfügen fünf Staaten über ein dauerhaftes Vetorecht: die Vereinigte Staaten, Russland, China, Frankreich und das Vereinigtes Königreich. Diese Konstruktion bedeutet faktisch: Jene Mächte, die das Völkerrecht am wirkungsvollsten brechen können, entscheiden zugleich darüber, wann es gebrochen wurde. Das ist kein moralisches Versagen, sondern systemische Realität.
Ein Imperium interpretiert Recht nicht aus Unterordnung, sondern aus Souveränität. Es ist sich seiner selbst so sicher, dass es sich Regelbrüche leisten kann – und oft auch leisten muss, um imperiale Ordnung zu stabilisieren.
Dieses Muster ist nicht neu. Die Vereinigten Staaten haben es im Fall von Saddam Hussein perfektioniert. Erst Verbündeter, dann Diktator, schließlich Dämon. Der zweite Irakkrieg wurde moralisch personalisiert. Dass der Irak zuvor in Kuwait einmarschiert war, ließ sich verwerten – doch der eigentliche Kern lag woanders: Öl. Kuwait war und ist strategisch relevant. Eine Tankstelle Amerikas.
Ein Imperium zu sein, ist selten ein sauberes Geschäft. Meist ist es ein schmutziges. Das zeigt auch Libyen. Auch dort wurde ein Regime im Namen von Menschenrechten gestürzt. Zurück blieb ein zerstörter Staat. Moralischer Sieg, strategisches Chaos.
Ein oft übersehener, aber aufschlussreicher Fall ist die US-Intervention in Panama Ende der 1980er Jahre. Unter dem Namen Operation Just Cause marschierten amerikanische Truppen 1989 ein, um den ehemaligen Verbündeten Manuel Noriega festzunehmen – offiziell wegen Drogenhandels und autoritärer Herrschaft. Der Einsatz war kurz, militärisch eindeutig und politisch effektiv. Noriega wurde abgeführt, ein Regimewechsel vollzogen, die Kontrolle über den strategisch zentralen Panamakanal gesichert. Moralische Debatten spielten kaum eine Rolle. Gerade in ihrer Schnelligkeit zeigt sich die imperiale Normalität solcher Operationen.
Wie weit diese amoralische Logik reichen kann, zeigte ein Satz, der bis heute nachhallt. 1996 fragte die Journalistin Lesley Stahl die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright, ob es den Preis wert gewesen sei, dass durch die Irak-Sanktionen rund eine halbe Million Kinder gestorben seien. Ihre Antwort lautete:
„I think this is a very hard choice, but the price—we think the price is worth it.“
„Ich denke, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber der Preis – wir halten den Preis für gerechtfertigt.“
Dieser Satz ist kein Ausrutscher. Er ist ehrlich. Interessen kennen keine Unschuld. Sie kennen Kosten.
Südamerika ist in dieser Hinsicht ein klassischer Einflussraum der USA. Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Brasilien – das Muster ist bekannt: Militärhilfe, Sanktionen, Regimewechselrhetorik. Keine Moral, sondern Struktur.
Und genau hier wird der Blick nach Deutschland entscheidend. Die deutsche Politik neigt dazu, ihr außenpolitisches Handeln moralisch zu begründen. Das wirkt sensibel, verantwortungsbewusst, historisch reflektiert – führt aber häufig zu einer paradoxen Situation: Man glaubt, aus Moral zu handeln, und betreibt doch Interessenpolitik.
Die Waffenlieferungen an die Ukraine beispielsweise gelten in der deutschen Bundesregierung als nahezu selbstverständlicher moralischer Akt. Der Aggressor ist klar benannt, die Rollen scheinen eindeutig. Doch diese Lesart blendet wesentliche Aspekte des Konflikts aus – etwa die massiven Artilleriebeschüsse russischstämmiger Gebiete seit 2014. Das relativiert keinen Angriffskrieg, zeigt aber, wie vielschichtig reale Konflikte sind.
CDU-Chef Friedrich Merz brachte diese Haltung mit dem Satz auf den Punkt, Deutschland stehe an der Seite der Ukraine „whatever it takes“. Doch diese moralische Eindeutigkeit hat auch materielle Konsequenzen: Deutschland hat der Ukraine seit Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 bislang Hilfen im Umfang von rund 44 Milliarden Euro bereitgestellt – einschließlich militärischer und ziviler Unterstützung. Gleichzeitig wurden große Summen für die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten sowie Integrationsleistungen geleistet. Diese Dimensionen haben reale Auswirkungen auf den deutschen Staatshaushalt, auf öffentliche Investitionen und am Ende auf den Steuerzahler.
Die Frage, ob dies moralisch „richtig“ ist, hängt entscheidend davon ab, welche moralischen Prioritäten man setzt: Sollte der Fokus primär auf der Sicherheit und Wohlfahrt der eigenen Bevölkerung liegen – etwa Finanzierung von Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen – oder auf der Unterstützung eines fremden Staates in einem existenziellen Konflikt? Dass die Bundesregierung diesen Kurs so langfristig und weitreichend wählt, führt zu tiefgreifenden finanziellen Belastungen: für den Haushalt insgesamt, für künftige Verpflichtungen und für die Ausstattung staatlicher Kernaufgaben.
Damit berührt diese Debatte auch den Amtseid der Bundesregierung: Der Bundeskanzler und die Minister schwören, „Schaden vom deutschen Volk abzuwenden“. Aus dieser Perspektive kann man kritisch hinterfragen, ob und in welchem Umfang finanzielle Mittel in einem fremden Kriegskonflikt eingesetzt werden sollten, wenn sie zugleich für dringend benötigte nationale Aufgaben fehlen – von Infrastrukturprojekten über soziale Sicherungssysteme bis hin zu Innovation und Bildung.
Ähnlich problematisch ist der Begriff des sogenannten „Sondervermögens“ der Bundeswehr. Sprachlich suggeriert er Rücklagen, Verfügbarkeit, finanzielle Leichtigkeit. Tatsächlich handelt es sich um massive Neuverschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe – Schulden, die nicht abstrakt sind, sondern von der eigenen Bevölkerung getragen werden müssen. Sie dienen primär der Aufrüstung und binden künftige Haushalte langfristig, während Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder soziale Sicherung weiter unter Druck geraten. Der Begriff ist politischer Marketing-Sprech: Er kaschiert, dass hier nicht Vermögen geschaffen, sondern Verpflichtungen aufgebaut werden – auch und gerade gegenüber dem eigenen Volk..
In dieser Gesamtschau zeigt sich: Die moralische Lesart der Ukraine-Unterstützung ist politisch verständlich, aber ebenso deutlich selektiv. Sie blendet nicht nur komplexe historische und militärische Aspekte aus, sondern übersieht auch, dass Politik im täglichen Handeln letztlich Eigeninteressen und Pflicht gegenüber dem eigenen Volk erfüllen muss. Dabei darf Moral nicht zum Deckmantel werden, der kritische Fragen verdrängt.
Ein ähnliches Muster zeigt sich im Umgang der deutschen Politik mit Israel. Die viel zitierte „Staatsräson“ dient hier als moralischer Fixpunkt, als historisch begründete Verpflichtung, Seite an Seite zu stehen – politisch, diplomatisch und militärisch. Deutschland liefert Waffen, unterstützt Israel sicherheitspolitisch und betont zugleich das Existenzrecht des jüdischen Staates. Diese Haltung ist aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar und in ihrer Grundintention nachvollziehbar.
Doch so offenbart sich die Ambivalenz moralischer Politik. Denn deutsche Waffen, die im Rahmen dieser Staatsräson geliefert werden, töten nicht abstrakt, sondern konkret – auch Zivilisten, auch Kinder, etwa im Gazastreifen. Die moralische Argumentation, mit der diese Unterstützung gerechtfertigt wird, blendet diese Realität häufig aus oder ordnet sie einem höheren Zweck unter. Die Perspektive Israels wird betont, das zivile Leid auf der Gegenseite hingegen relativiert oder kommunikativ eingehegt.
Damit wiederholt sich das bekannte Muster: Moral dient als Begründung politischen Handelns, nicht als Maßstab seiner Folgen. Wer die israelische Sicherheit betont, muss zugleich anerkennen, dass militärische Mittel immer unscharf wirken. Wer auf Staatsräson verweist, darf die ethischen Brüche nicht ausblenden, die mit Waffenexporten einhergehen. Beides gleichzeitig zu denken ist unbequem – aber notwendig.
Die moralische Bewertung hängt vom Blickwinkel ab. Für die einen ist die deutsche Haltung Ausdruck historischer Verantwortung, für die anderen eine Form selektiver Empathie. Politisch jedoch bleibt die Entscheidung interessengeleitet: Deutschland positioniert sich strategisch, bündnispolitisch und historisch – nicht neutral, nicht unparteiisch, sondern konsequent innerhalb eines eigenen Koordinatensystems.
Ein weiteres Beispiel für einen moralinen Kampfbegriff: die Migration. Auch hier kollidiert moralische Selbstbeschreibung mit politischer Realität. Migration ist kein abstraktes Projekt, sondern ein tiefgreifender Eingriff in staatliche, soziale und kulturelle Ordnungen. Sie verändert Gesellschaften nachhaltig – demografisch, finanziell, lebensweltlich. Und sie bringt, jenseits aller moralischen Intentionen, reale Folgen mit sich: Gewalt, Opfer, Tote.
Diese Realität lässt sich nicht durch den Verweis auf humanitäre Motive aufheben. Migration ist politisch wirksam, unabhängig davon, wie sie moralisch gerahmt wird. Sie beeinflusst innere Sicherheit, soziale Kohäsion, kommunale Haushalte und das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Ordnung. Das sind keine bloßen Narrative, sondern empirisch erfahrbare Phänomene, die sich dem Alltag vieler Bürger einschreiben.
Dass diese Folgen nicht nur abstrakt sind, zeigt ein konkreter Fall: der Tod von Maria Ladenburger, die 2016 in Freiburg im Breisgau von einem abgelehnten Asylbewerber ermordet wurde. Dieser Fall steht exemplarisch für eine Wahrheit, die politisch häufig ausgeblendet wird: migrationspolitische Entscheidungen können unmittelbare Konsequenzen für Leib und Leben haben. Gewalt und Tod sind keine theoretischen Risiken, sondern reale Möglichkeiten – und für die Betroffenen endgültige Tatsachen.
Gerade deshalb verbietet sich eine rein moralische Betrachtung. Wer Migration ausschließlich als humanitäres Projekt beschreibt, entzieht sich der Verantwortung, auch ihre Schattenseiten zu benennen. Ein Staat, der Sicherheit nicht gewährleisten kann oder will, verliert Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage politischer Ordnung.
Das bekannte Muster: Moral dient als Rechtfertigung politischen Handelns, während die konkreten Folgen in der Lebensrealität der Bevölkerung externalisiert werden. Die Frage ist nicht, ob Mitgefühl legitim ist. Die Frage ist, ob Politik sich allein an moralinen Imperativen orientieren darf – oder ob sie nicht vielmehr verpflichtet ist, die Interessen, die Sicherheit und die Lebenswirklichkeit des eigenen Volkes in den Mittelpunkt zu stellen.
Was folgt daraus?
Für mich bleibt vor allem eines: Distanz. Distanz zu moralischen Schnellurteilen, Distanz zur reflexhaften Lagerlogik, Distanz zur Illusion, geopolitische Realität lasse sich ethisch sauber auflösen. Genau diese Illusion aber prägt große Teile der öffentlichen Debatte.
Befremdlich wirkt dabei, wie bereitwillig sich sowohl das rechte als auch das linke politische Lager vor den Karren geostrategischer Interventionen spannen lassen – nur eben aus entgegengesetzten Richtungen. Das linke Spektrum kritisiert den Einsatz in Venezuela nun mit großer Vehemenz: wegen der militärischen Intervention, wegen der Verletzung des Völkerrechts, wegen der Abführung Maduros. Was dabei häufig ausgeblendet wird, ist die Realität seiner Herrschaft. Nicolás Maduro regierte nicht bloß autoritär, sondern repressiv: mit systematischen Menschenrechtsverletzungen, politischer Verfolgung, willkürlichen Inhaftierungen und dem Einsatz regierungsnaher Sicherheitskräfte und Milizen gegen die eigene Bevölkerung. Diese Fakten verschwinden im moralischen Protest gegen den Akt der Intervention selbst.
Umgekehrt verfällt das rechte Lager in eine spiegelbildliche Verkürzung. Dort wird der Eingriff als Sieg über Sozialismus oder Kommunismus gefeiert, als Befreiungsschlag gegen ein linkes Unrechtsregime. Auch hier ersetzt Moral die Analyse. Der Machtakt einer Großmacht wird ideologisch aufgeladen und zum symbolischen Triumph umgedeutet. Dass es sich dabei primär um einen geostrategischen Eingriff handelt, tritt in den Hintergrund.
Beide Lesarten greifen zu kurz. Die eine verschweigt reale Unterdrückung, die andere verklärt Machtpolitik. Beides verbietet sich. Denn weder wurde Maduro aus humanitären Gründen gestürzt, noch ist seine Herrschaft deshalb zu verteidigen gewesen. Wer den Einsatz moralisch verdammt oder moralisch feiert, bleibt im gleichen Deutungsrahmen gefangen – und genau dieser Rahmen ist Teil des Problems.
Natürlich ist Kritik notwendig. Zivile, moralische Kritik ist legitim und wichtig. Sie hilft bei der persönlichen Einordnung, bei der politischen Selbstvergewisserung, bei der Formulierung von Haltung. Doch sie erklärt keine Macht. Internationale Politik orientiert sich nicht an Moral – und hat es nie getan.
Wer Interventionen moralisch interpretiert, macht sich – unabhängig davon, ob er sie befürwortet oder ablehnt – zum Helfershelfer eines geopolitischen Spiels. Großmächte handeln nicht, weil sie Recht haben, sondern weil sie Macht haben. Sie sichern Einflusssphären, Ressourcen und strategische Ordnung. Nicht aus Bosheit, sondern weil sie Imperien sind – und Imperien denken egozentrisch oder sie zerfallen.
Für Venezuela bedeutet das nüchtern betrachtet: Ein Machtwechsel geschieht aus geostrategischen Gründen. Nicht, weil jemand böse ist, sondern weil er im Weg steht. Ob es der Bevölkerung dadurch besser gehen wird, ist offen. Geschichte lehrt hier Zurückhaltung statt Optimismus.
Konflikte sind vielschichtig. Ihre Triebkräfte oft erstaunlich simpel. Wer bereit ist, ohne ideologische Brille hinzusehen, erkennt: Moral hilft beim Bewerten – aber nicht beim Verstehen.
Im Schatten der Werte liegt keine Erlösung.
Aber dort beginnt Realität.